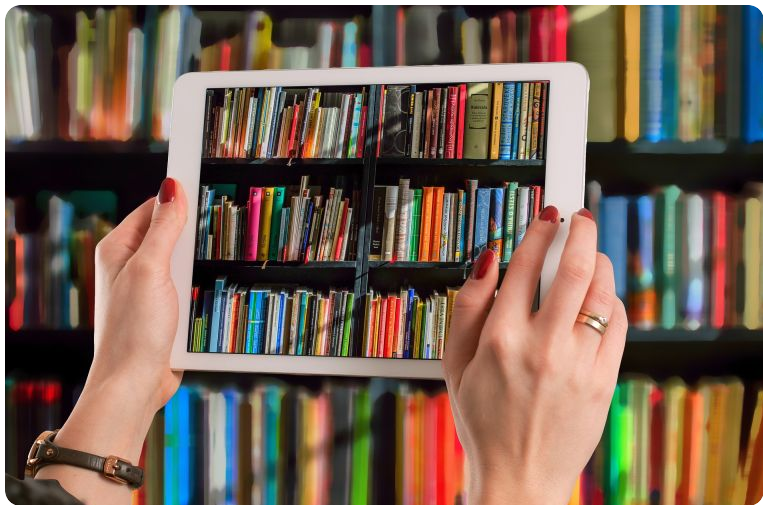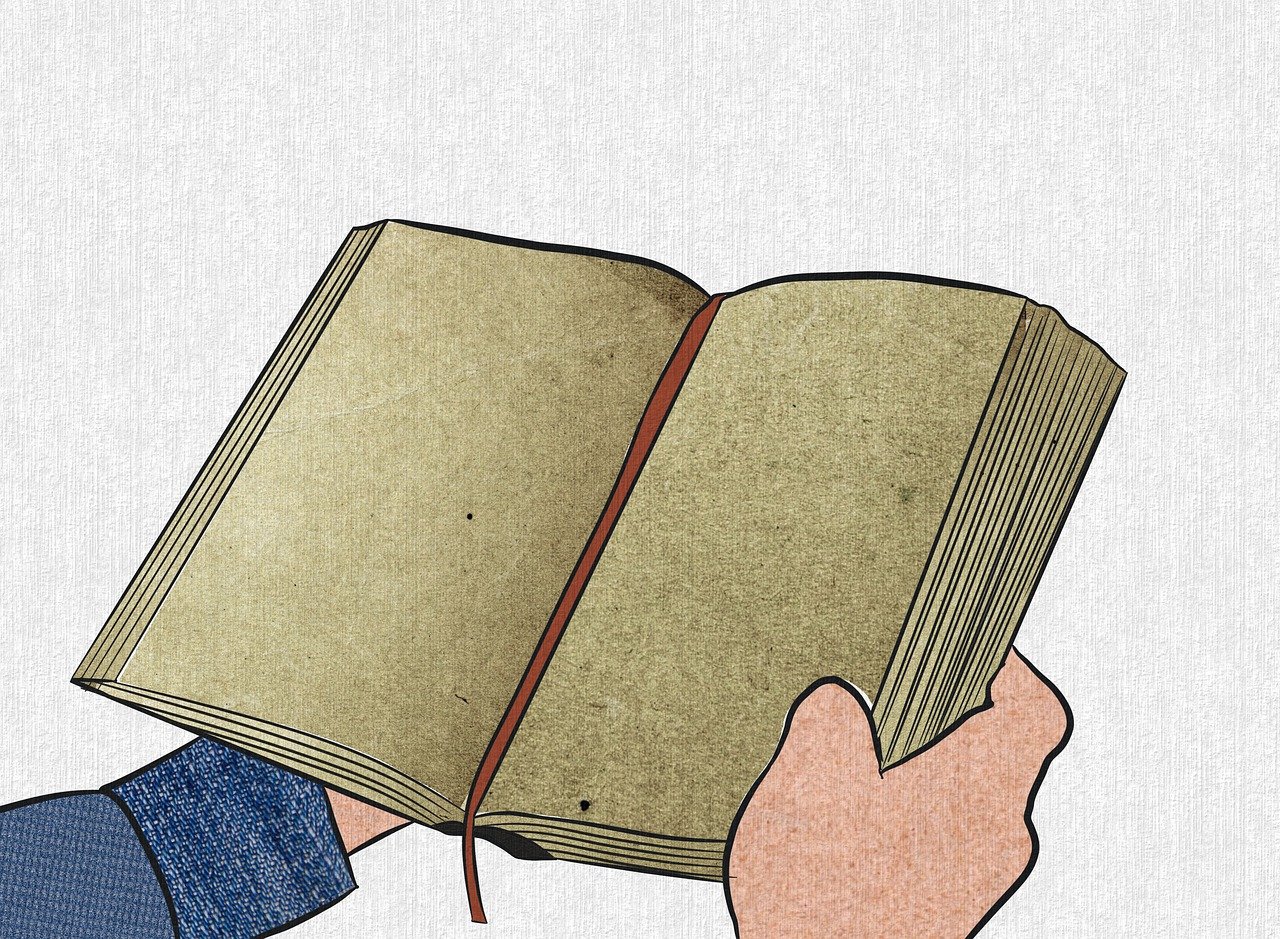Modell des Monats Mai 2025
Ad Astra: Vom A4 zum Sputnik
Vom Original zum Modell
Ein eigenständiger Teil der Sammlungen des Luftfahrtmuseums Hannover-Laatzen sind die mehr als 1.000 Maßstabsmodelle, vornehmlich der internationalen Standards 1/72, 1/48 und 1/32.
Solche originalgetreuen Miniaturen ermöglichen Betrachtern musealer Technikgeschichte den „Überblick“ auf Entwicklungslinien des Flugzeug- und Flugkörperbaus durch hier mögliche Reihung und Gegenüberstellung. Manchmal bieten sie Ergänzungen zur Präsentation der Originale. Ihre kunsthandwerkliche Qualität allein ist ein Schauvergnügen.
Heute stellen wir Ihnen in unserer Reihe ´Modell des Monats´ die Anfänge des Fernraketen- und Raumfluges vor: Vom deutschen Aggregat 4 aus dem Jahr 1942 zur sowjetrussischen Sputnik-Trägerrakete von 1957, mit geringen Modifikationen abgeleitet von der ersten einsatzfähigen ballistischen Interkontinentalrakete R 7.

Die Modelle
In den Modellvitrinen der Halle 2 finden sich unter verschiedenen Flugkörpern mit und ohne Eigenantrieb, welche von der seinerzeit führenden deutschen Luftfahrtindustrie entwickelt wurden und zum Teil im Einsatz standen, auch zwei Miniaturen der weltweit ersten Fernrakete A4.
Zudem stellen wir Ihnen hier einen aus dem Fundus des Luftfahrtmuseums gebauten Modell-Kit der ersten operativen Raumfahrt-Trägerrakete der Welt, der sowjetischen R 7 vor, welche 1957 den ersten Satelliten „Sputnik“ auf eine Umlaufbahn brachte. Im Maßstab 1/144 gehalten, editierte der Moskauer Hersteller APEX diesen Bausatz in den späten 1980er Jahren in einer Serie zur sowjetischen Raumfahrt, darunter die R 7 in verschiedenen Konfigurationen.

In 1/144 ist die R 7 der Sputnik-Mission gut 21 cm lang – im Original waren das imposante rund 30 m. Modellbausätze sowjet-/-russischer Raumflugkörper sind bis heute in unserer Hemisphäre eher selten und gemessen an ihrer weltweiten Bedeutung bei westeuropäischen und amerikanischen Herstellern durchaus unterrepräsentiert.
Die Originale
So ist der Mensch. Kaum hatte er sich den uralten Traum vom Fliegen erfüllt, wollte er weiter zu den Sternen – Ad Astra, wie der Lateiner sagt.
Nach den geistig-wissenschaftlichen Vorarbeiten des russischen Ingenieurs und Vordenkers Konstantin E. Ziolkowski („Erforschung des Weltraumes mittels Reaktionsapparaten“, 1903) und der deutschen Wissenschaftler Hermann Oberth („Wege zur Raumschiffahrt“, 1929) und Eugen Sänger („Raketenflugtechnik“, 1933) gelang der erste praktische Schritt in diese Richtung am 3. Oktober 1942 von Peenemünde aus mit dem erfolgreichen Flug der von Wernher von Braun und seinem Team entwickelten Fernrakete A4. Eine ganze Reihe von Starts mit Rekorden, aber auch Fehlschlägen folgte.
Das Weltall touchiert
Nie zuvor war ein von Menschen geschaffenes Objekt mit Eigenantrieb so schnell (5.600 km/h) und so hoch (Apogäum 170 km) geflogen; die Beschleunigung und Steigrate der einstufigen Flüssigkeitsrakete mit 14,30 m Länge und 13,3 t Gewicht übertraf alle bisherigen Vorstellungen. Es war der erste Flugkörper, welcher in den Weltraum vordrang, dessen Grenze bei 100 km über Normalnull festgelegt ist. Doch diese technischen Superlative blieben zunächst weitgehend geheim.

Denn das Heereswaffenamt hatte die Mittel und Einrichtungen zur Entwicklung für eine praktische Nutzanwendung zur Verfügung gestellt, schließlich befand man sich (mitten) im Krieg und suchte permanent nach neuen Waffen. So wurde aus dem „Aggregat 4“ die „Vergeltungswaffe 2“, von der 5.500 Stück produziert und mit einem Sprengkopf von einer Tonne versehen gegen westeuropäische Städte und Logistikzentren eingesetzt wurde. Und diese „V2“, von den Bedienungsmannschaften nur „das Gerät“ genannt, blieb die einzige Waffe des 2. Weltkrieges, gegen die es – bei einer Vorwarnzeit z.B. für London von wenigen Sekunden – keine Abwehrmöglichkeit gab. Jedoch ließ die konventionelle Bestückung keinen strategischen, sondern lediglich einen taktischen, vornehmlich aber psychologischen Effekt zu. Leidtragend war auch hier wie im alliierten Bombenkrieg vor allem die Zivilbevölkerung. Beschämend aber bleibt die massenhafte Zwangsarbeit politischer Gefangener und Entrechteter in der Produktion der V2.
Technologietransfer
Nach der deutschen Niederlage 1945 wurde auch und besonders die gesamte Raketentechnologie (mitunter samt Wissenschaftspersonal) von den Siegern beschlagnahmt, mitgenommen und ausgewertet – und zur Grundlage eigener Luft- und Raumfahrtvorhaben.
Und wie schon in Deutschland gingen bei den Westalliierten und der UdSSR hierbei Forschung und militärische Absichten Hand in Hand, während beide Seiten ihr Raketenarsenal auf der V2-Technik aufbauten und Raumfahrtperspektiven entwickelten.

Dabei zeigte sich die Sowjetunion zur Überraschung des Westens auf dem Weg ins Weltall führend und blieb es bis zur amerikanischen Mondlandung 1969. Neben einer dort ausgeprägt vorhandenen technischen Abilität (welche man sich im Westen lange schwertat, anzuerkennen) beförderte ein totalitäres Regime wie zuvor in Deutschland die Konzentration der Kräfte. Kopf des sowjetischen Raketenprogramms war Sergei P. Koroljow, Schüler Ziolkowskis; während Wernher von Braun, von den USA eingebürgert, Chef der NASA und ´Vater´ des bislang größten Raumfahrterfolges, der Mondlandung des Menschen wurde.

Nach dem erfolgreichen Testflug der weltweit ersten ballistischen Interkontinentalrakete R 7 in der Sowjetunion im August 1957 folgte bereits am 4. Oktober des gleichen Jahres der Start eines geringfügig modifizierten Exemplars der zweistufigen Flüssigkeitsträgerrakete als „8K71PS“ mit dem ersten Satelliten der Menschheit, dem sprichwörtlich gewordenen „Sputnik“, auf Deutsch „Trabant“.
Und diese technische Pioniertat war zugleich eine Leistungsschau des Sowjetmilitärs –auch die Farbgebung dieser ersten Raumfahrt-Trägerrakete legt die Vermutung nahe,
dass sie der mit der R 7 anlaufenden Serienproduktion der Atomwaffenträger entnommen wurde. Spätere Exemplare des Raumfahrtprogramms trugen eine neutrale Lackierung.
Der Satellit „Sputnik“ selbst war eine Metallkugel von 58 cm Durchmesser und 83,6 kg Gewicht mit Mess- und Funktechnik. Unter der Spitze der Zentraleinheit ins All transportiert und dort auf eine Umlaufbahn gesetzt, sandte er 3 Wochen lang auf seinen Erdumrundungen bei 577 km mittlerer Höhe auf zwei Frequenzen Funksignale zur Ortung und Bahnverfolgung aus.
Der Westen war im „Sputnik-Schock“ – und blieb es noch lange nachdem der vom Kosmodrom Baikonur aus gestartete Satellit nach 92 Tagen plangemäß beim Abstieg in der Erdatmosphäre verglüht war.

Denn nach zwei weiteren erfolgreichen Sputnik-Missionen umrundete am 12. April 1961 Major Juri Gagarin in seiner von einer nun dreistufigen R 7 ins All getragenen „Wostok 1“-Raumkapsel in 108 Minuten Flugzeit als erster Mensch im All unseren Planeten – die Menschheit war im Weltraum angekommen…
Datenblatt Fernrakete A4:
Länge: 14,30 m; Durchmesser max: 1,65 m (ohne Heckflossen); Startgewicht: 13,3 t; Treibstoff: Alkohol und Flüssigsauerstoff; Höchstgeschwindigkeit: 5.600 km/h (Mach 4,5). Nutzlast: 1 t.
Datenblatt Trägerrakete R 7 Sputnik-Mission:
Länge: 29,16 m; Durchmesser max: 10,30 m (mit Außenblocks); Startgewicht: 267 t; Treibstoff: Kerosin und Oxygen; Höchstgeschwindigkeit: bis zu 24.500 km/h (Mach 20). Nutzlast: 1,4 t.
Willkommen!
Konnten wir Sie neugierig machen auf unsere Sammlungen mit über 40 Originalen und originalgetreuen Nachbauten von Segel-, Leicht-, Verkehrs- und Militärflugzeugen, noch einmal so vielen Triebwerken und Hunderten von Ausrüstungsgegenständen sowie unserer Modellsammlung? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch in der Ulmer Straße am hannoverschen Messegelände: Wir sehen uns!
sb
Kontakt zum Autor der Modell-des-Monats-Reihe können Sie hier aufnehmen: Autor-MdM